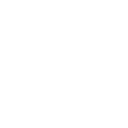Seriöse und unabhängige Kurz-Gutachten für Ihre Immobilie
Mit einem Kurzgutachten von Horizont Immobilien – Peter Stosik Immobilien-Ökonom (VWA), erhalten Sie eine fachkundige und verlässliche Einschätzung zum Marktwert Ihrer Immobilie. Peter Stosik Immobilien-Ökonom erstellt Ihnen ein Kurzwertgutachten für die verschiedensten Immobilienarten und Objekte. Dabei berücksichtigen wir grundsätzlich immer die jeweiligen Gesetzesgrundlagen und bieten Ihnen unsere Leistungen zur Festpreisgarantie an. Zu den Immobilienarten und Objekten, die wir für Sie mit einem Kurzgutachten bewerten, gehören:
- Eigentumswohnungen
- Ein- und Zweifamilienhäuser
- Mehrfamilienhäuser
- Reihenhäuser
- Doppelhaushälften
- Gewerbeimmobilien
- Baugrundstücke
- Hallen/Garagen etc.
Als Grundsatz gilt: Ein Kurzgutachten kommt prinzipiell nur infrage, wenn es sich um private Anliegen handelt, wie zum Beispiel den Immobilienkauf oder -verkauf, außergerichtliche Einigungen bei Scheidung oder Erbe sowie die Vermögensplanung. Ein Kurzgutachten für Immobilien ist zwar genauso fundiert wie ein Vollgutachten (sogenanntes Verkehrswertgutachten), hat vor Gericht und auf Behörden aber keine Gültigkeit. Handelt es sich also um gerichtliche Angelegenheiten oder sind Behörden beteiligt, müssen Sie ein umfangreiches Verkehrswertgutachten durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen erstellen lassen.
Welche Kosten fallen bei einem Kurzgutachten für Ihr Haus oder Ihre Wohnung an?
✓ Ihr Vorteil: Im Rahmen eines kostenlosen Erstgesprächs klären wir mit Ihnen alle wichtigen Punkte für die Erstellung des Kurzgutachtens für Ihre Immobilie. Auf dieser Basis garantieren wir Ihnen unser Angebot zur Festpreisgarantie. Das heißt: Sollte der Arbeitsaufwand höher sein als ursprünglich angenommen, bleibt es beim vereinbarten Preis für Sie. Kontaktieren Sie uns und sichern Sie sich Ihre kostenlose Erstberatung. Nutzen Sie dafür einfach unser Kontaktformular oder melden Sie sich telefonisch unter Tel: 0202/963 44 -08 E-Mail info@wuppertal-immobilien.info. Wir nehmen schnellstmöglich Kontakt mit Ihnen auf. Immobilien-Ökonom – Peter Stosik ermittelt die sinnvollsten Maßnahmen für Ihr Anliegen: kostenlos und unverbindlich.